Mies, Scharoun, Herzog & de Meuron
Um den Platz und die Kosten für den Erweiterungsbau von Mies van der Rohes Nationalgalerie am Kulturforum ist noch einmal kräftig gestritten worden. Das Museum des 20. Jahrhunderts, wichtigster Berliner Kulturbau der kommenden Jahre, ist jetzt in der Spur. Jacques Herzog gibt Auskunft über den Stand der Planung.
Text: Schade-Bünsow, Boris, Berlin; Geipel, Kaye, Berlin
Anzeige
Mies, Scharoun, Herzog & de Meuron
Um den Platz und die Kosten für den Erweiterungsbau von Mies van der Rohes Nationalgalerie am Kulturforum ist noch einmal kräftig gestritten worden. Das Museum des 20. Jahrhunderts, wichtigster Berliner Kulturbau der kommenden Jahre, ist jetzt in der Spur. Jacques Herzog gibt Auskunft über den Stand der Planung.
Text: Schade-Bünsow, Boris, Berlin; Geipel, Kaye, Berlin
Um die Debatte des zurückliegenden Herbstes noch mal zusammenzufassen: Warum ist der Platz für das neue Gebäude genau der richtige?
Weil der Wettbewerb dort stattgefunden hat. Ich würde die Frage umstellen: Weshalb sollte dieser Ort nicht geeignet sein? Es ist so ein hässlicher Ort, eine Brache mitten in der Stadt, umgeben von Gebäuden, die für sich dastehen – all diese berühmten Gebäude, die Philharmonie, die Bibliothek, die Nationalgalerie, sogar die Piazzetta, sind völlig abgeschottete, stumme Monumente. Von daher drängt es sich geradezu auf, etwas zu verändern.
Weil der Wettbewerb dort stattgefunden hat. Ich würde die Frage umstellen: Weshalb sollte dieser Ort nicht geeignet sein? Es ist so ein hässlicher Ort, eine Brache mitten in der Stadt, umgeben von Gebäuden, die für sich dastehen – all diese berühmten Gebäude, die Philharmonie, die Bibliothek, die Nationalgalerie, sogar die Piazzetta, sind völlig abgeschottete, stumme Monumente. Von daher drängt es sich geradezu auf, etwas zu verändern.
Der Begriff des Kulturforums kommt aus den sechziger Jahren und hat zu tun mit solitären Einzelbauten und der Idee einer Freifläche dazwischen. Die Debatte trifft genau dieses Dilemma: Was machen wir mit der Konzeption aus den sechziger Jahren?
Ich denke, dass schon der Begriff „Forum“ falsche Erwartungen weckt, weil er suggeriert, dass sich Leute auf einem freien Feld bewegen. Ich glaube, das funktioniert nicht im Norden, im Klima von Berlin. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die bestehenden Gebäude in Beziehung zueinander bringen, und deshalb haben wir die Aufgabe von Anfang an als Konzept der Dichte verstanden. Unser Ansatz war es, den ganzen Platz, der
zur Verfügung stand, auszureizen, um Nähe zu schaffen und nicht Ferne. Davon gibt es genug.
Ich denke, dass schon der Begriff „Forum“ falsche Erwartungen weckt, weil er suggeriert, dass sich Leute auf einem freien Feld bewegen. Ich glaube, das funktioniert nicht im Norden, im Klima von Berlin. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die bestehenden Gebäude in Beziehung zueinander bringen, und deshalb haben wir die Aufgabe von Anfang an als Konzept der Dichte verstanden. Unser Ansatz war es, den ganzen Platz, der
zur Verfügung stand, auszureizen, um Nähe zu schaffen und nicht Ferne. Davon gibt es genug.
Wie würden Sie das städtebauliche Leitbild beschreiben, das Sie mit dem Neubau verfolgen?
Als Konzept der Dichte und der Nachbarschaften, der Bezüge zwischen den bestehenden Bauten. Die Begegnung der Stadt mit den Menschen ist im Neubau enthalten, in den Boulevards, die wir hinein verlegen, auf den Platz. Das Volumen schafft klar definierte Räume sowohl zur Philharmonie als auch zur Bibliothek als auch zur Piazzetta als auch zur Nationalgalerie. Bis jetzt sind in diesem Umfeld keine definierten Räume vorhanden.
Als Konzept der Dichte und der Nachbarschaften, der Bezüge zwischen den bestehenden Bauten. Die Begegnung der Stadt mit den Menschen ist im Neubau enthalten, in den Boulevards, die wir hinein verlegen, auf den Platz. Das Volumen schafft klar definierte Räume sowohl zur Philharmonie als auch zur Bibliothek als auch zur Piazzetta als auch zur Nationalgalerie. Bis jetzt sind in diesem Umfeld keine definierten Räume vorhanden.
Die Beziehung zur Staatsbibliothek von Scharoun ist geprägt durch die breite Potsdamer Straße, eine Schneise.
Das ist ein momentaner Zustand. Wir wissen alle, dass sich die Mobilität verändert. Ich bin überzeugt, dass das irgendwann ein Boulevard sein wird, mit viel mehr Grün und viel durchlässiger. Und ich bin sicher, dass die Öffnung, die wir nach Osten anbieten, eine Chance ist für den Einbezug der Bibliothek, die ein großes Potenzial ist in diesem kulturellen Kontext.
Das ist ein momentaner Zustand. Wir wissen alle, dass sich die Mobilität verändert. Ich bin überzeugt, dass das irgendwann ein Boulevard sein wird, mit viel mehr Grün und viel durchlässiger. Und ich bin sicher, dass die Öffnung, die wir nach Osten anbieten, eine Chance ist für den Einbezug der Bibliothek, die ein großes Potenzial ist in diesem kulturellen Kontext.
Nach dem Sanierungswettbewerb, den gmp gewonnen hat, bleibt der Haupteingang an der Straße, neue öffentliche Funktionen werden sich aber zur anderen Seite, zum Potsdamer Platz hin, orientieren. Es ist für das Kulturforum wichtig, dass sich die angrenzenden Institutionen – die Bibliothek, die Philharmonie, die Kunstinstitutionen hinter der Piazzetta – öffnen und Bezüge eingehen wollen, wie es beispielsweise die Kirche schon macht. Das ist wie ein Schritt nach draußen, aber das ist nur durch Nähe möglich. Die Außenräume, die entstehen, müssen eine überschaubare Größe haben und sich klar unterscheiden in ihrer Qualität: die Piazzetta, der Scharounplatz usw. Über diese Räume könnten die einzelnen Institutionen in Beziehung treten, gemeinsam Angebote entwickeln. Musik, Bildende Kunst, die Bild- und die Literaturarchive, das sind alles Dinge, die verwandt sind. Unsre ganze Kultur ist multimedial aufgestellt.
Für wen wird dieser Ort sein? Ist es ein Ort, der nur für Museumsbesucher und Touristen ist, oder passiert da mehr?
Auch das hängt davon ab, wie das bespielt wird. Ich sehe das für alle Menschen. Wichtig ist, dass Projekte auch im Außenraum stattfinden. Da können Popkonzerte stattfinden, Lesungen, Filmprojektionen. Das wird möglich durch unser Konzept, weil es Distanzen überwindet.
Auch das hängt davon ab, wie das bespielt wird. Ich sehe das für alle Menschen. Wichtig ist, dass Projekte auch im Außenraum stattfinden. Da können Popkonzerte stattfinden, Lesungen, Filmprojektionen. Das wird möglich durch unser Konzept, weil es Distanzen überwindet.
Die Architekturform spielt eine Rolle bei der Frage: Wen adressiert der Neubau? Das zeigt sich auch in den Nicknames, die bereits kursieren, von der „Scheune“ über „LIDL“ bis zum „Tempel“. Sie haben von Anfang an gesagt, es sei „ein Haus“. Uns hat das irritiert, weil das Gebäude selber ein erstaunliches Hybrid ist, Platz und Gebäude gleichzeitig, so dass mir der Ausdruck „Haus“ etwas defensiv erscheint. Welcher dieser Nicknames würde Ihnen denn zusagen?
Alle. Das, was Sie Hybrid nennen, kann ich auch Paradox nennen oder Komplexität. Diese bildhaften Assoziationen, die die Leute mit dem Giebeldach verbinden, mögen polemisch gemeint sein, sie haben aber auch etwas Positives. Eine Scheune etwa hat mit Nahrung zu tun, mit Vorrat, mit dem, was draußen passiert und was hinein kommt – auch geistige Nahrung. Das Gebäude ist aber auch ein Depot, ist wie eine Bahnhofhalle, vielleicht ein bisschen wie ein Tempel, weil Kunst auch damit zu tun hat, dass man sie anschaut. Wahrnehmen hat etwas mit Stille und einer gewissen Besinnlichkeit zu tun. Aber eben nicht nur. Wir sind keine Architekten, die den Menschen abverlangen, dass sie in Ehrfurcht vor den Wänden stehen, wir wollen die ganze Unterschiedlichkeit der heutigen Großstadt zeigen. Es ist interessant, dass dieses Dach so erfolgreich war bei der Jury und so provokativ, weil es eine scheinbar banale Geste ist, verglichen mit dem abstrakten Raffinement von Mies und mit dem expressiven Ausdruck bei Scharoun. Dieses Dach ist das Einzige, was funktioniert hat. Es gab wohl noch keinen Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben, wo es so schwierig war, eine Typologie zu definieren, ein Gebäude, das nicht unter dieser Nachbarschaft leidet und sich souverän behauptet, ohne dass es sich wichtig machen muss. Ich glaube, das ist uns genau durch diese archaische Form des Hauses gelungen.
Alle. Das, was Sie Hybrid nennen, kann ich auch Paradox nennen oder Komplexität. Diese bildhaften Assoziationen, die die Leute mit dem Giebeldach verbinden, mögen polemisch gemeint sein, sie haben aber auch etwas Positives. Eine Scheune etwa hat mit Nahrung zu tun, mit Vorrat, mit dem, was draußen passiert und was hinein kommt – auch geistige Nahrung. Das Gebäude ist aber auch ein Depot, ist wie eine Bahnhofhalle, vielleicht ein bisschen wie ein Tempel, weil Kunst auch damit zu tun hat, dass man sie anschaut. Wahrnehmen hat etwas mit Stille und einer gewissen Besinnlichkeit zu tun. Aber eben nicht nur. Wir sind keine Architekten, die den Menschen abverlangen, dass sie in Ehrfurcht vor den Wänden stehen, wir wollen die ganze Unterschiedlichkeit der heutigen Großstadt zeigen. Es ist interessant, dass dieses Dach so erfolgreich war bei der Jury und so provokativ, weil es eine scheinbar banale Geste ist, verglichen mit dem abstrakten Raffinement von Mies und mit dem expressiven Ausdruck bei Scharoun. Dieses Dach ist das Einzige, was funktioniert hat. Es gab wohl noch keinen Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben, wo es so schwierig war, eine Typologie zu definieren, ein Gebäude, das nicht unter dieser Nachbarschaft leidet und sich souverän behauptet, ohne dass es sich wichtig machen muss. Ich glaube, das ist uns genau durch diese archaische Form des Hauses gelungen.
Das war die Sorge, dass eines der beiden Gebäude darunter leidet?
Mies ist nicht zu überbieten mit dieser abstrakten, puren Form. Das kannst du gar nicht steigern. Aber sich Scharoun annähern geht auch nicht, auch das kannst du nicht besser machen.
Mies ist nicht zu überbieten mit dieser abstrakten, puren Form. Das kannst du gar nicht steigern. Aber sich Scharoun annähern geht auch nicht, auch das kannst du nicht besser machen.
Es ist immer die Rede gewesen von den beiden Boulevards, die durch das Gebäude führen. Bei der Überarbeitung der Pläne hat man gesehen, es ist nicht nur ein Achsenkreuz, sondern so eine Art dreidimensionales Wunderwerk, ein räumlicher Magic Cube.
Sie haben es gut beschrieben. Wenn es nur ein Achsenkreuz wäre, wäre eszu banal. Das Haus hat nicht ein Oben und Unten in einem hierarchischen, sondern in einem topografischen Sinn. Es gibt darin also nicht einen besseren und einen weniger guten Raum, sondern es ist ein Abenteuer, etwas Lustvolles, durch dieses Haus zu gehen. Du entdeckst völlig unterschiedliche Orte. Ausstellungsräume sind in Museen oft etwas repetitiv. Aber hier hast du ganz unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Lichtverhältnisse. Das hat sich im Laufe der Arbeit verändert, dass sich auf dem Boulevard seitlich Räume öffnen. Es ist nicht unähnlich den riesigen Basiliken, wo seitlich kleine Tempel, Nischen, Bänke, ausgegrabene Objekte sind. Dort bist du immer in diesem einen Raum und hast trotzdem immer wieder ganz spezifische Orte. Das empfinde ich als ein brauchbares Modell. Sie haben vorhin gefragt: Für wen ist das? Natürlich muss der Kunstliebhaber seinen Ort finden, Ruhe, damit die Kunstwerke sich entfalten können. Aber wir müssen auch einen Ort schaffen, wo du gern hingehst, wo du dich triffst, weil das ein interessanter Ort ist, um sich zu treffen. Du gehst da vielleicht auch hin, weil du weißt, dass da andere Leute sind, weil es vielleicht eine gute Bar hat. Als Treffpunkt ist es eine zeitgenössische Form von Forum.
Sie haben es gut beschrieben. Wenn es nur ein Achsenkreuz wäre, wäre eszu banal. Das Haus hat nicht ein Oben und Unten in einem hierarchischen, sondern in einem topografischen Sinn. Es gibt darin also nicht einen besseren und einen weniger guten Raum, sondern es ist ein Abenteuer, etwas Lustvolles, durch dieses Haus zu gehen. Du entdeckst völlig unterschiedliche Orte. Ausstellungsräume sind in Museen oft etwas repetitiv. Aber hier hast du ganz unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Lichtverhältnisse. Das hat sich im Laufe der Arbeit verändert, dass sich auf dem Boulevard seitlich Räume öffnen. Es ist nicht unähnlich den riesigen Basiliken, wo seitlich kleine Tempel, Nischen, Bänke, ausgegrabene Objekte sind. Dort bist du immer in diesem einen Raum und hast trotzdem immer wieder ganz spezifische Orte. Das empfinde ich als ein brauchbares Modell. Sie haben vorhin gefragt: Für wen ist das? Natürlich muss der Kunstliebhaber seinen Ort finden, Ruhe, damit die Kunstwerke sich entfalten können. Aber wir müssen auch einen Ort schaffen, wo du gern hingehst, wo du dich triffst, weil das ein interessanter Ort ist, um sich zu treffen. Du gehst da vielleicht auch hin, weil du weißt, dass da andere Leute sind, weil es vielleicht eine gute Bar hat. Als Treffpunkt ist es eine zeitgenössische Form von Forum.
Sie wollen das Museum mit einer kommunikativen Funktion aufladen?
Ja. Das Tolle an der Architektur und vor allem an der öffentlichen Architektur ist, dass sie Potenzial hat, ein Ort zu sein, wo Sachen möglich werden, die du erst durch dieses Gebäude entdeckst. In der freien Natur geht jeder zu Orten, zu denen er sich hingezogen fühlt: eine Höhle oder ein Baum oder ein Absatz in der Landschaft, der wie eine Bank ist. Als Architekt kannst du solche Orte bauen.
Ja. Das Tolle an der Architektur und vor allem an der öffentlichen Architektur ist, dass sie Potenzial hat, ein Ort zu sein, wo Sachen möglich werden, die du erst durch dieses Gebäude entdeckst. In der freien Natur geht jeder zu Orten, zu denen er sich hingezogen fühlt: eine Höhle oder ein Baum oder ein Absatz in der Landschaft, der wie eine Bank ist. Als Architekt kannst du solche Orte bauen.
Wir haben festgestellt, dass sich die Fassaden im Zuge der Weiterbearbeitung weiter differenziert haben, insbesondere zur Philharmonie hin mit Cafe und großer Treppe. Es ist aufgefallen, dass jetzt jede Fassade ein eigenes Kapitel aufschlägt.
Das war unsere Aufgabe. Wir hören natürlich, was die Kritiker sagen. Aber wir wissen auch, was wir verändern wollen. Es muss kohärent bleiben. Jede Seite stimmt jetzt immer mehr. Es hat sich, seit Sie es das letzte Mal gesehen haben, nochmals ziemlich verändert, vor allem die Giebelfassade zur Philharmonie. Wir wussten aber, dass wir das Innenleben nach außen stülpen wollen. Die Einzelfunktionen und ihre unterschiedlichen Proportionen kannst du in einem Wettbewerb gar nicht so entwickeln. Die Aufgabe der Jury ist es auch zu erkennen, wo Potenziale liegen. Und dann ist es wichtig, dass wir als Architekten solche Potenziale entwickeln dürfen. Die Seiten, die wir den bestehenden Institutionen zuwenden, wollen Angebote machen.
Das war unsere Aufgabe. Wir hören natürlich, was die Kritiker sagen. Aber wir wissen auch, was wir verändern wollen. Es muss kohärent bleiben. Jede Seite stimmt jetzt immer mehr. Es hat sich, seit Sie es das letzte Mal gesehen haben, nochmals ziemlich verändert, vor allem die Giebelfassade zur Philharmonie. Wir wussten aber, dass wir das Innenleben nach außen stülpen wollen. Die Einzelfunktionen und ihre unterschiedlichen Proportionen kannst du in einem Wettbewerb gar nicht so entwickeln. Die Aufgabe der Jury ist es auch zu erkennen, wo Potenziale liegen. Und dann ist es wichtig, dass wir als Architekten solche Potenziale entwickeln dürfen. Die Seiten, die wir den bestehenden Institutionen zuwenden, wollen Angebote machen.
Wie sieht es aus Richtung Nationalgalerie?
Gegenüber dieser statischen Form gibt es auf unserer Seite dynamische Elemente. Diese Öffnungen, die wie Hangar-Tore aussehen, sind gleichzeitig Screens oder Spiegel. Es ist eine Architektur der Gesten. Zu Mies hin gibt es diese schräg gestellte Platte, die auch eine Geste des Öffnens ist und anzeigt, dass an der Stelle eine Beziehung entsteht. Das wird auf der Ebene der Fassade vorbereitet. Dann gibt es eine unterirdische Beziehung, die aber nicht irgendeine Passage ist, sondern da sind Ausstellungsräume. Wir wollen nicht einfach eine Fassade machen und dann ist Schluss, sondern wir wollen Beziehung haben, den Blick zu Mies öffnen.
Gegenüber dieser statischen Form gibt es auf unserer Seite dynamische Elemente. Diese Öffnungen, die wie Hangar-Tore aussehen, sind gleichzeitig Screens oder Spiegel. Es ist eine Architektur der Gesten. Zu Mies hin gibt es diese schräg gestellte Platte, die auch eine Geste des Öffnens ist und anzeigt, dass an der Stelle eine Beziehung entsteht. Das wird auf der Ebene der Fassade vorbereitet. Dann gibt es eine unterirdische Beziehung, die aber nicht irgendeine Passage ist, sondern da sind Ausstellungsräume. Wir wollen nicht einfach eine Fassade machen und dann ist Schluss, sondern wir wollen Beziehung haben, den Blick zu Mies öffnen.
Was passiert auf Straßenniveau, dort wo auf der anderen Seite der Sockel von Mies an die Straße reicht?
Es ist zwar ein anderes Gebäude, aber es gibt die erwähnte unterirdische Verbindung. Sonst müsste man diese Gebäude zusammenfügen oder die Straße aufheben. Was ich sinnvoll fände. Das kann aber auch eine spätere Generation machen, etwa mittels einer Ausgrabung zwischen unserem Bau und dem von Mies. Ein abgesenkter Hof, von dem her Seitenlicht in die unterirdische Verbindung eindringt. Also eine Typologie, die an die von Mies angelehnt ist, die diese Sprache weiterführt.
Es ist zwar ein anderes Gebäude, aber es gibt die erwähnte unterirdische Verbindung. Sonst müsste man diese Gebäude zusammenfügen oder die Straße aufheben. Was ich sinnvoll fände. Das kann aber auch eine spätere Generation machen, etwa mittels einer Ausgrabung zwischen unserem Bau und dem von Mies. Ein abgesenkter Hof, von dem her Seitenlicht in die unterirdische Verbindung eindringt. Also eine Typologie, die an die von Mies angelehnt ist, die diese Sprache weiterführt.
Was erwidern Sie denen, die sagen, das ist die Seite, an der am wenigsten passiert, in der bloß Gebäude gegen Gebäude stößt?
Mies van der Rohe hat seine Nationalgalerie auf einen blinden Sockel gehoben. Ohne Fenster zur Strasse. Er wollte keinen Dialog mit Aussen aufnehmen. Die Abgeschlossenheit war quasi Programm. Dadurch sollte die Transparenz und abstrakte Schönheit seiner Stahlkonstruktion noch stärker leuchten. Das war Mies’ wichtigstes Anliegen. Eine beinahe religiöse, zumindest aber ideologische Haltung in seiner Suche nach einem idea-len Stil für die Moderne. Das ist ihm gelungen, niemand hat zu seiner Zeit vergleichbare Ikonen geschaffen. Das war aber auch Ausdruck einer Limitiertheit. Er war wie gefangen in diesem radikalen Anspruch. Und auch die Menschen, die das nutzen, sind darin gefangen.Heute funktioniert die Stadt eben anders. Der Anspruch an öffentliche Bauten ist nicht mehr bloss die Repräsentanz, sondern der Dialog, der Austausch mit der Kunst und zugleich mit anderen Menschen. Die geplante unterirdische Verbindung der beiden Gebäude wird dies leisten. Ausserdem gibt es in unserem Bau im ersten Geschoss ein grosses Fenster und eine dazugehörige Sitznische mit einem spektakulären Blick auf die Nationalgalerie.
Mies van der Rohe hat seine Nationalgalerie auf einen blinden Sockel gehoben. Ohne Fenster zur Strasse. Er wollte keinen Dialog mit Aussen aufnehmen. Die Abgeschlossenheit war quasi Programm. Dadurch sollte die Transparenz und abstrakte Schönheit seiner Stahlkonstruktion noch stärker leuchten. Das war Mies’ wichtigstes Anliegen. Eine beinahe religiöse, zumindest aber ideologische Haltung in seiner Suche nach einem idea-len Stil für die Moderne. Das ist ihm gelungen, niemand hat zu seiner Zeit vergleichbare Ikonen geschaffen. Das war aber auch Ausdruck einer Limitiertheit. Er war wie gefangen in diesem radikalen Anspruch. Und auch die Menschen, die das nutzen, sind darin gefangen.Heute funktioniert die Stadt eben anders. Der Anspruch an öffentliche Bauten ist nicht mehr bloss die Repräsentanz, sondern der Dialog, der Austausch mit der Kunst und zugleich mit anderen Menschen. Die geplante unterirdische Verbindung der beiden Gebäude wird dies leisten. Ausserdem gibt es in unserem Bau im ersten Geschoss ein grosses Fenster und eine dazugehörige Sitznische mit einem spektakulären Blick auf die Nationalgalerie.
Wird die Verbindung bei der Sanierung der Nationalgalerie vorbereitet?
Ja, diese ist aber nicht vorgesehen in der ersten Etappe, aber wir haben sie geplant und alle Maßnahmen getroffen, damit diese Verbindung gebautwerden kann. Es soll eine räumliche Sequenz sein mit Ausstellungsflächen, nicht bloss ein unterirdischer Korridor. Auch haben wir uns dazu mit David Chipperfield ausgetauscht, der die Renovationsarbeiten am Mies Bau leitet.
Ja, diese ist aber nicht vorgesehen in der ersten Etappe, aber wir haben sie geplant und alle Maßnahmen getroffen, damit diese Verbindung gebautwerden kann. Es soll eine räumliche Sequenz sein mit Ausstellungsflächen, nicht bloss ein unterirdischer Korridor. Auch haben wir uns dazu mit David Chipperfield ausgetauscht, der die Renovationsarbeiten am Mies Bau leitet.
Wie sieht es aus zur Staatsbibliothek? Scharoun hat sich im Masterplan von 1964 auch auf die Idee der verkehrsgerechten Stadt bezogen. Anfangs gab es in Ihrem Projekt einen Schwung zur Potsdamer Straße, der mittlerweise entfallen ist. Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sagte, dass das neue Museum auch Städtebau macht. Das war offensichtlich die gestellte Aufgabe. Aber macht das Gebäude auch Verkehrsplanung? Kann es auf der Stabi-Seite den ungeliebten Highway transformieren?
Die Potsdamer Straße bleibt auch in Zukunft wichtig, aber wird sicher zurückgebaut. Die verkehrsplanerische Seite ist eher in diesem Zurückbauen als in einer Fantasie-Vision zu sehen. Diese Krümmung, die wir im Gebäude hatten, war ein Versuch, den archaischen Formen so einen Twist zu geben. Dann haben wir gemerkt, dass wir das gar nicht brauchen, da es Dinge gibt, die viel interessanter sind. Die Herausforderung, auf die bestehenden Gebäude zuzugehen, sich zu öffnen – das ist die zentrale Funktion des Entwurfs, viel mehr als irgendetwas Verkehrsplanerisches.
Die Potsdamer Straße bleibt auch in Zukunft wichtig, aber wird sicher zurückgebaut. Die verkehrsplanerische Seite ist eher in diesem Zurückbauen als in einer Fantasie-Vision zu sehen. Diese Krümmung, die wir im Gebäude hatten, war ein Versuch, den archaischen Formen so einen Twist zu geben. Dann haben wir gemerkt, dass wir das gar nicht brauchen, da es Dinge gibt, die viel interessanter sind. Die Herausforderung, auf die bestehenden Gebäude zuzugehen, sich zu öffnen – das ist die zentrale Funktion des Entwurfs, viel mehr als irgendetwas Verkehrsplanerisches.
Wenn wir den Blick auf ganz Berlin richten bzw. auf das, was momentan auf der Museumsinsel entsteht – welche Art von atmosphärischer Qualität für die Stadt als Repräsentationsort stellen Sie sich am Kulturforum vor? Wie manifestiert sich dieser Ort im Verhältnis zum anderen Pol weiter östlich?
Die Museumsinsel ist ein Konzept des 19. Jahrhunderts. Das Kulturforum dagegen ist eine radikale Idee des 20., des 21. Jahrhunderts, weil es ganz andere disparate Gebäude hat. Dort lässt sich die Entwicklung der Moderne bis in die Gegenwart ablesen. Der Neubau von uns ergänzt diesen Ort zu einem Ort der Dichte, der von heute ist und als Gegenpol verstanden werden kann. Vielleicht wird das ein Auslöser sein für weitere Transformationen. Bei der Potsdamer Straße bin ich sicher, dass sich etwas verändern wird. Vielleicht auch auf der Seite der Piazzetta. Die Gemäldegalerie ist von ihren Beständen her unglaublich, es ist aber unglaublich traurig, in diesem Gebäude zu sein, das überhaupt keine Aufenthaltsqualität bietet. Das hat ein großes Potenzial für eine kommende Generation, das zu ergänzen, und die Idee eines Kulturforums der Dichte weiter zu treiben.
Die Museumsinsel ist ein Konzept des 19. Jahrhunderts. Das Kulturforum dagegen ist eine radikale Idee des 20., des 21. Jahrhunderts, weil es ganz andere disparate Gebäude hat. Dort lässt sich die Entwicklung der Moderne bis in die Gegenwart ablesen. Der Neubau von uns ergänzt diesen Ort zu einem Ort der Dichte, der von heute ist und als Gegenpol verstanden werden kann. Vielleicht wird das ein Auslöser sein für weitere Transformationen. Bei der Potsdamer Straße bin ich sicher, dass sich etwas verändern wird. Vielleicht auch auf der Seite der Piazzetta. Die Gemäldegalerie ist von ihren Beständen her unglaublich, es ist aber unglaublich traurig, in diesem Gebäude zu sein, das überhaupt keine Aufenthaltsqualität bietet. Das hat ein großes Potenzial für eine kommende Generation, das zu ergänzen, und die Idee eines Kulturforums der Dichte weiter zu treiben.
Das Kulturforum also ein Ort des Zukunftsoptimismus, die Museumsinsel ein Ort der Vergangenheit?Das sehe ich nicht so, weil ich nicht unterscheide zwischen Qualität in der Vergangenheit und Gegenwart. Es ist einfach wichtig, dass du bei jedem Ort versuchst, das Spezifische zu stärken und zu ergänzen. Man hat die Museumsinsel bis heute weiter gebaut. Und das wird auch auf dem Kulturforum stattfinden. Das ist nicht abgeschlossen mit unserem Bau.
Was bleibt dann vom Erbe der sechziger Jahre in Bezug auf den Stadtraum? Wenn man an den Bauzäunen der Nationalgalerie vorbei läuft, sieht man Bilder aus den Sechzigern, eine kulturelle Selbstbehauptung in einer urbanen Wüste, ein eindrückliches Zeichen der Teilung Europas. Mies und Scharoun sind Ausdruck dieser Situation. Welche Vorstellungen haben Sie, um an diese Qualität der Ruppigkeit anzuschließen?
Wir haben nicht diese – ja beinahe – Sehnsucht nach Hässlichkeit und Ruppigkeit, die man erhalten sollte. In Berlin ist das aber immer wieder ein Thema, und an gewissen Orten auch angebracht, weil man nicht alles glatt bügeln sollte, was in einer Großstadt mit ihren historischen Bruchstellen im Verlaufe der Zeit entstanden ist.
Wir haben nicht diese – ja beinahe – Sehnsucht nach Hässlichkeit und Ruppigkeit, die man erhalten sollte. In Berlin ist das aber immer wieder ein Thema, und an gewissen Orten auch angebracht, weil man nicht alles glatt bügeln sollte, was in einer Großstadt mit ihren historischen Bruchstellen im Verlaufe der Zeit entstanden ist.
Die Frage bezog sich auch auf die Frage der künftigen Landschaftsplanung. Welchen Charakter wird diese haben?
Die Landschaftsplanung in den unmittelbar an unseren Bau angrenzenden Teilen macht Günther Vogt mit seinem Büro. Es werden sehr unterschiedliche Orte und Plätze entstehen, verschieden groß, mit ganz anderem Ausdruck. In unserem Bau, innen sozusagen, ist ja der Raum für die große Platane als eine Art Natur-Galerie. Insgesamt sehen wir die Aufgabe für diese unterschiedlichen landschaftlichen Orte und Plätze vergleichbar wie für die Gebäude selbst: einen Ort zu schaffen, der Berlin in einem positiven Sinne transformiert – nicht nur ein Ort der Erinnerung – sondern der ein Ort wird für die Leute von heute und von morgen. Das ist die einzige Aufgabe, die ich hier sehe.
Die Landschaftsplanung in den unmittelbar an unseren Bau angrenzenden Teilen macht Günther Vogt mit seinem Büro. Es werden sehr unterschiedliche Orte und Plätze entstehen, verschieden groß, mit ganz anderem Ausdruck. In unserem Bau, innen sozusagen, ist ja der Raum für die große Platane als eine Art Natur-Galerie. Insgesamt sehen wir die Aufgabe für diese unterschiedlichen landschaftlichen Orte und Plätze vergleichbar wie für die Gebäude selbst: einen Ort zu schaffen, der Berlin in einem positiven Sinne transformiert – nicht nur ein Ort der Erinnerung – sondern der ein Ort wird für die Leute von heute und von morgen. Das ist die einzige Aufgabe, die ich hier sehe.








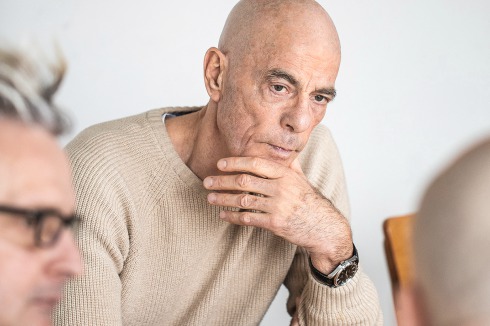



0 Kommentare