Form follows Nature
Text: Maier-Solgk, Frank, Düsseldorf
Form follows Nature
Text: Maier-Solgk, Frank, Düsseldorf
Was können wir von der Natur lernen? Können Planer, Ingenieure und Architekten aus den Prozessen, Strukturen und Formen der Natur Anregungen, gar Vorlagen für heutiges Bauen gewinnen?
Das Thema ist so komplex wie historisch ergiebig, reicht es doch zurück bis zu Altmeistern des organischen Bauens wie Alvar Aalto, Hans Poelzig, Frank Lloyd Wright oder Antoni Gaudi, von anthroposophischen Nebenlininien nicht zu reden. Was jedoch als lediglich origineller Zweig der Architekturgeschichte erscheinen mag, verdient aufgrund der heutigen Bau-Leitbilder – Nachhaltigkeit und Ökologie – vielleicht doch einen genaueren Blick. Die Natur, so sagt man, sei effektiv, sie verschenke nichts, sie werfe nichts weg, ihre Gesetze seien zum Zweck des Lebenserhaltes erprobt. Die Eierschale steht nun einmal für einen effizienten Umgang mit Material und Energie. Der Sammelband „Form follows Nature“ sieht die Fragen, die in diesem Zusammenhang gewissermaßen an die Natur gestellt werden, als bei weitem nicht ausreichend behandelt. „Die meisten Architekten“, so Frei Otto, der in dem Band mit einem Interview und mehreren Beiträgen zu Wort kommt, „wollen bauen, Ideen verwenden, (aber) sie nicht wissenschaftlich weiterführen. Sie scheuen den mühsamen Weg der Forschung.“
Forschung also: Entsprechend diesem Diktum geht es in den 25 komplexen und meist dicht geschriebenen Fachbeiträgen aus unterschiedlichen Disziplinen nicht in erster Linie um Ästhetik oder um zukünftiges Design. Auch die jüngere biomorphe Architektur ist bestenfalls am Rande Thema. Stattdessen behandeln die Aufsätze eher biologistisch die „Patterns der Natur“, das „Konstruieren nach biologischen Vorbildern“, sprich das Fach Bionik; sie analysieren Seifenblasen, sie untersuchen „Schalentiere und Seeigel“, „wachsende und sich teilende Pneus“ oder die Struktur von Bienenwaben. Auch berühmte Vorgänger der heutiger Naturwissenschaftler kommen in dieser Geschichte des Lehrmeisters Natur zu Wort: Der Naturphilosoph Ernst Haeckel etwa (mit einem Aufsatz aus dem Jahr 1899), der Astronom Johannes Kepler (über die räumlichen Strukturen von Bienenwaben), der Goldschmied Wenzel Jamnitzer (Perspektiva corporum regularium) oder der Biologe Sir Wentworth Thompson (über Skelettbildung bei Schwämmen). Die Anregungen, die aus solchen Naturstudien resultieren, sind auch im Detail spannend, gleich, ob es sich um die Blätter der Lotuspflanze handelt, den Reibungswiderstand von Haifischhaut oder gar algorithmisch erfassbare Relationen (z.B. Fibonacci-Reihe, Regel des goldenen Schnitts), die nicht nur Strukturen der lebenden Natur konstituieren, sondern sich auch als proportionale Konstanten in der Architekturgeschichte wiederfinden (so der Aufsatz „Formsache“ von D. Dolezel).
Das Buch belässt es jedoch nicht bei solcherart Beispielen: Das japanische Wohnhaus, für manche in seinen natürlichen Materialien das Modell eines natürlichen Hauses überhaupt, oder die Wohnbauten von Naturvölkern, von den Schneehütten der Eskimos über die Cliff Dwellings der Pueblo Indianer bis zur afrikanischen Lehmbauweise, sind ebenso behandelt wie die Architektur von F.L. Wright.
Den meisten Autoren ist wichtig, dass das Ziel nicht in Bauweisen gesehen werden kann, die Naturformen lediglich imitieren. Für die Zukunft maßgeblich seien Erkenntnisse, die aus den Analyse von Naturgesetzlichkeiten folgen. Entsprechend wissenschaftlich ist der Tenor. Ein Projekt, das neue Architekturformen aus Funktionen, Materialien oder Zwecken der Natur gewinnen will, mag der Skepsis gegenüber einer globalen Markenarchitektur geschuldet sein; der Rahmen diese Buchprojekts ist in erster Linie jedoch gesellschaftspolitisch: Im Vorwort setzt Rudolf Finsterwalder in dieser Hinsicht den denkbar größten Rahmen: Wir brauchen einen die Natur einschließenden kategorischen Imperativ, die 2000-Watt-Gesellschaft, die in Maßen auf Komfort- und Bequemlichkeit zu verzichten lernt. Das Naturstudium als Propädeutikum für das Überleben der Spezies.
Forschung also: Entsprechend diesem Diktum geht es in den 25 komplexen und meist dicht geschriebenen Fachbeiträgen aus unterschiedlichen Disziplinen nicht in erster Linie um Ästhetik oder um zukünftiges Design. Auch die jüngere biomorphe Architektur ist bestenfalls am Rande Thema. Stattdessen behandeln die Aufsätze eher biologistisch die „Patterns der Natur“, das „Konstruieren nach biologischen Vorbildern“, sprich das Fach Bionik; sie analysieren Seifenblasen, sie untersuchen „Schalentiere und Seeigel“, „wachsende und sich teilende Pneus“ oder die Struktur von Bienenwaben. Auch berühmte Vorgänger der heutiger Naturwissenschaftler kommen in dieser Geschichte des Lehrmeisters Natur zu Wort: Der Naturphilosoph Ernst Haeckel etwa (mit einem Aufsatz aus dem Jahr 1899), der Astronom Johannes Kepler (über die räumlichen Strukturen von Bienenwaben), der Goldschmied Wenzel Jamnitzer (Perspektiva corporum regularium) oder der Biologe Sir Wentworth Thompson (über Skelettbildung bei Schwämmen). Die Anregungen, die aus solchen Naturstudien resultieren, sind auch im Detail spannend, gleich, ob es sich um die Blätter der Lotuspflanze handelt, den Reibungswiderstand von Haifischhaut oder gar algorithmisch erfassbare Relationen (z.B. Fibonacci-Reihe, Regel des goldenen Schnitts), die nicht nur Strukturen der lebenden Natur konstituieren, sondern sich auch als proportionale Konstanten in der Architekturgeschichte wiederfinden (so der Aufsatz „Formsache“ von D. Dolezel).
Das Buch belässt es jedoch nicht bei solcherart Beispielen: Das japanische Wohnhaus, für manche in seinen natürlichen Materialien das Modell eines natürlichen Hauses überhaupt, oder die Wohnbauten von Naturvölkern, von den Schneehütten der Eskimos über die Cliff Dwellings der Pueblo Indianer bis zur afrikanischen Lehmbauweise, sind ebenso behandelt wie die Architektur von F.L. Wright.
Den meisten Autoren ist wichtig, dass das Ziel nicht in Bauweisen gesehen werden kann, die Naturformen lediglich imitieren. Für die Zukunft maßgeblich seien Erkenntnisse, die aus den Analyse von Naturgesetzlichkeiten folgen. Entsprechend wissenschaftlich ist der Tenor. Ein Projekt, das neue Architekturformen aus Funktionen, Materialien oder Zwecken der Natur gewinnen will, mag der Skepsis gegenüber einer globalen Markenarchitektur geschuldet sein; der Rahmen diese Buchprojekts ist in erster Linie jedoch gesellschaftspolitisch: Im Vorwort setzt Rudolf Finsterwalder in dieser Hinsicht den denkbar größten Rahmen: Wir brauchen einen die Natur einschließenden kategorischen Imperativ, die 2000-Watt-Gesellschaft, die in Maßen auf Komfort- und Bequemlichkeit zu verzichten lernt. Das Naturstudium als Propädeutikum für das Überleben der Spezies.


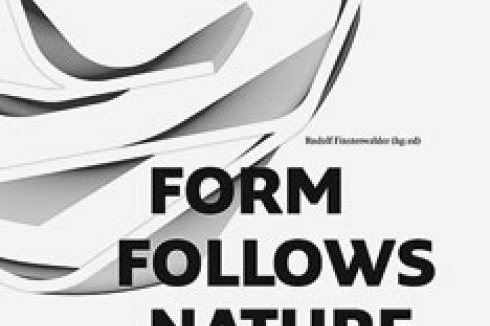





0 Kommentare