Überall und nirgendwo
Der Schriftsteller Jan Brandt kämpft in seinem neuen Buch an zwei Fronten des Wohnungsmarktes. In Berlin begibt er sich auf die Odyssee einer Wohnungssuche; in seiner Heimat Ostfriesland setzt er sich für den Erhalt des Hauses seines Urgroßvaters ein. Zwei Welten, eng miteinander verwoben.
Text: Crone, Benedikt, Berlin
Überall und nirgendwo
Der Schriftsteller Jan Brandt kämpft in seinem neuen Buch an zwei Fronten des Wohnungsmarktes. In Berlin begibt er sich auf die Odyssee einer Wohnungssuche; in seiner Heimat Ostfriesland setzt er sich für den Erhalt des Hauses seines Urgroßvaters ein. Zwei Welten, eng miteinander verwoben.
Text: Crone, Benedikt, Berlin
Wir sitzen in einem Café in der Nähe des Berliner Parks am Gleisdreieck, in Nachbarschaft zu einigen Neubauten, die hier in den letzten fünf Jahren entstanden sind (Bauwelt 9.2019). Hätten Sie sich bei Ihrer Wohnungssuche vorstellen können, in einem der Neubauten zu wohnen?
Es ist ja gar nicht mehr die Frage, wie ich wohnen will, sondern was ich mir leisten kann. Da bleibt nicht so viel übrig – man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich habe die Wohnungsanzeigen für diese Neubauten hier im Kiez gesehen. Das sind Quadratmeterpreise, die ich nicht habe bezahlen können. Neubau kommt deswegen für mich nicht in Frage. Vom Mietpreis abgesehen finde ich aber, dass speziell einer dieser Neubauten zur Straße so abgeriegelt wirkt, als müsse er die Bewohner vor der Stadt schützen. Hier spräche auch die Architektur gegen meinen Einzug.
Sie haben am Ende eine Wohnung in einem Altbau in Berlin-Schöneberg gefunden. Sind Sie glücklich?
Ja. Aber es ist nicht so, dass ich mir diese Wohnung ausgesucht habe. Es war die einzige von etwa 40 Wohnungen, auf die ich mich beworben hatte, die ich bekommen hab. Bei den anderen bin ich aus dem Bewerberpool herausgefallen: zu große Konkurrenz, zu geringes Einkommen, Freiberufler.
In Ihrem Buch schildern Sie, wie Ihnen in Ihrer Kreuzberger Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt wird. Der Sohn des Vermieters will angeblich mit seiner Familie einziehen. Bei dem Punkt ertappte ich mich beim Lesen dabei, wie mein Mitleid mit Ihnen, dem Protagonisten, ins Wanken geriet. Stattdessen verspürte ich so etwas wie moralische Missgunst: Sie wohnten in bester Lage auf 100 Quadratmeter zu einer günstigen Miete. Warum sollten Sie nicht Platz machen für eine Familie? Warum sollte es Ihnen besser ergehen als mir selbst, als ich vor vier Jahren nach einer Wohnung suchte?
Das Gefühl, das Sie beschreiben, kann ich nachvollziehen. Mir war es bei der Erzählung wichtig, dass jeder von uns beides ist: Täter und Opfer. Natürlich wirkt mein Raumanspruch dekadent, wohnungspolitisch und ökologisch. Es gibt aber Berufe, die einen größeren Platzbedarf haben – Künstler brauchen zum Beispiel ein Atelier, Selbständige oft ein Arbeitszimmer.
Das Gefühl, das Sie beschreiben, kann ich nachvollziehen. Mir war es bei der Erzählung wichtig, dass jeder von uns beides ist: Täter und Opfer. Natürlich wirkt mein Raumanspruch dekadent, wohnungspolitisch und ökologisch. Es gibt aber Berufe, die einen größeren Platzbedarf haben – Künstler brauchen zum Beispiel ein Atelier, Selbständige oft ein Arbeitszimmer.
Sie haben viele Bücher.
Viele Bücher und den Bedarf an einem eigenen Schreibzimmer. Diese Trennung ist wichtig für meine Produktivität. Auf lange Sicht wird es aber wohl darauf hinauslaufen, dass ich mich entweder verkleinern oder die Stadt verlassen muss. Sonst frisst die Miete mein gesamtes Einkommen auf.
Sie vergleichen Ihre Erfahrungen mit dem Wohnungsmarkt der Großstadt mit dem Häusermarkt in Ihrem Heimatdorf Ihrhove, Ostfriesland. Gibt es eine ähnliche Entwicklung in beiden Welten?
Die Entwicklung erscheint mir ähnlich, auch wenn die Voraussetzungen unterschiedlich sind: In Berlin werden rund 85 Prozent der Wohnungen von Mietern bewohnt, in Ostfriesland vermutlich zu 85 Prozent von Eigentümern. Da in dem Dorf, aus dem ich komme, jedoch kaum Bauland ausgewiesen wird und gleichzeitig die Leute, die sich die Miete in den umliegenden Städten nicht mehr leisten können, dort hinziehen, steigen auch in dieser Region die Preise, auch für Mietwohnungen. Das ist neu. Früher herrschte auf dem Land das Dogma des Einfamilienhauses, jetzt werden erstmals – auch wegen der Alterung der Gesellschaft – Mehrfamilienhäuser mit überschaubaren Wohnungen nachgefragt.
Sie kämpfen neben einer Unterkunft in Berlin auch für den Erhalt des 150 Jahre alten friesischen Landhauses Ihres Urgroßvaters. Das Haus, das lange Zeit über einen Gemischtwarenladen verfügte, befindet sich nicht mehr im Familienbesitz. Es soll einem Neubau für altersgerechte Wohnungen weichen. Ging es Ihnen bei Ihrem Engagement ausschließlich darum, einen Abriss zu verhindern oder hatten Sie auch Angst vor dem Neuen, das an die Stelle des Alten treten würde?
Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen einen Neubau, wenn es ein Neubau ist, der unserer Gesellschaft gerecht wird in einer Weise, die mutig, kühn und zukunftsweisend ist. Ich kannte den Bauherren, der gleichzeitig Architekt ist, und wusste, was für Häuser er baut. In meinem Dorf hat er eine ganze Altensiedlung geplant, gleichartige Häuser, ebenerdig, rein funktionsorientiert. Ohne dass ich den Entwurf des Neubaus kannte, den er anstelle des Hauses meines Urgroßvaters errichten wollte, war mir klar, das wird ein wuchtiges, uninspiriertes, architektonisch rein pragmatisches Gebäude.
Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen einen Neubau, wenn es ein Neubau ist, der unserer Gesellschaft gerecht wird in einer Weise, die mutig, kühn und zukunftsweisend ist. Ich kannte den Bauherren, der gleichzeitig Architekt ist, und wusste, was für Häuser er baut. In meinem Dorf hat er eine ganze Altensiedlung geplant, gleichartige Häuser, ebenerdig, rein funktionsorientiert. Ohne dass ich den Entwurf des Neubaus kannte, den er anstelle des Hauses meines Urgroßvaters errichten wollte, war mir klar, das wird ein wuchtiges, uninspiriertes, architektonisch rein pragmatisches Gebäude.
Im Buch zeigen Sie ein Bild des Neubaus (siehe Fotos oben).
Das erste, was Sie heute sehen, wenn Sie auf das Haus zugehen, sind Carports, gefolgt von einer bunkerartigen Wand mit kleinen Fenstern wie Schießscharten. Die großen Fenster und Balkone sind zwar nach Süden ausgerichtet, aber die Seite zur Hauptverkehrsstraße, zum Dorf, bleibt verschlossen. Alles, was der Bau ausdrückt, ist: Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Ich finde es schade, dass an die Stelle eines Hauses mit Laden, in das die Dorfbewohner ein- und ausgegangen sind, dieses abweisende Gebäude getreten ist.
Haben Sie mit dem Bauherrn über die Architektur geredet?
Nein, aber ich habe ihn kürzlich auf einer Lesung getroffen. Er sagte im Anschluss zu mir, die Lage des Hauses wäre einfach zu verlockend gewesen, zwischen Supermarkt und Ärztehaus. Er hätte alle Wohnungen sofort vermietet, trotz des hohen Preises von acht bis neun Euro den Quadratmeter. Darauf antwortete ich: Dann ist ja alles gut und die Welt in Ordnung. Er sagte nur: Ja.
Sie sprechen auch mit Bewohnern des Dorfes. Wie ist deren Blick auf das Neubauvorhaben?
Es scheint im Dorf weder ein Bewusstsein noch einen erkennbaren Willen zu geben, das Alte zu erhalten. Stattdessen gibt es ein städtebauliches Programm mit Bebauungsplänen, die weit über die bisherige Firsthöhe reichen, um aus dem Dorf eine Stadt zu machen. Alles soll signalisieren: Wir wollen über uns hinauswachsen und das Dörfliche hinter uns lassen. Ich glaube, dass das falsch ist.
Es scheint im Dorf weder ein Bewusstsein noch einen erkennbaren Willen zu geben, das Alte zu erhalten. Stattdessen gibt es ein städtebauliches Programm mit Bebauungsplänen, die weit über die bisherige Firsthöhe reichen, um aus dem Dorf eine Stadt zu machen. Alles soll signalisieren: Wir wollen über uns hinauswachsen und das Dörfliche hinter uns lassen. Ich glaube, dass das falsch ist.
Warum?
Weil das Dorf seinen Charakter verliert. Veränderung ist gut, aber man sollte darauf achten, das Individuelle eines Ortes zu erhalten. Stattdessen entwickelt sich der ländliche Raum architektonisch in eine Gleichförmigkeit, die alles öde und langweilig aussehen lässt. Es wird nicht versucht, andere Wege zu gehen, mit europäischen Förderungen oder mit überregionalen Architekten und Bauherren, die vielleicht andere Konzepte verfolgen. Man geht den Weg des geringsten Widerstandes, rein pragmatisch.
Weil das Dorf seinen Charakter verliert. Veränderung ist gut, aber man sollte darauf achten, das Individuelle eines Ortes zu erhalten. Stattdessen entwickelt sich der ländliche Raum architektonisch in eine Gleichförmigkeit, die alles öde und langweilig aussehen lässt. Es wird nicht versucht, andere Wege zu gehen, mit europäischen Förderungen oder mit überregionalen Architekten und Bauherren, die vielleicht andere Konzepte verfolgen. Man geht den Weg des geringsten Widerstandes, rein pragmatisch.
Spielt Architektur in der Region keine wesentliche Rolle?
Nicht erkennbar, weder ästhetisch noch räumlich. Vielmehr laufen Bauprojekte nach dem Motto: energetisch, praktisch, gut.
Nicht erkennbar, weder ästhetisch noch räumlich. Vielmehr laufen Bauprojekte nach dem Motto: energetisch, praktisch, gut.
Sie besuchen in dem Buch auch die USA und sagen, die Entwicklungen in Berlin und Ostfriesland sind nicht singulär. Ist alles so einfach vergleichbar?
Es ist schon ein globales Phänomen. Der Immobilienboom fördert in meinen Augen allerorten ähnliche Typen von Gebäuden und Häusern. Wohnungen sind Orte der Geldanlage und Spekulation geworden, dürfen auch leer stehen. Es wird teilweise blind gekauft, weil nur noch die Lage entscheidet. Wenn man zudem nicht selbst drin wohnt, ist es fast egal, wie das Haus aussieht.
Haben Sie einen Wunsch an Architekten?
In der Stadt fällt ein architektonisch schwaches Haus nicht so ins Gewicht – auf dem Land springt es einem dagegen sofort ins Auge. Hier würde ich mir mehr Rücksicht auf das Vorhandene wünschen, das mit etwas Neuem verbunden wird. In Ostfriesland kenne ich so ein Haus: das Haus am Deich von Thomas Kröger Architekten, das eine Neuinterpretation des traditionellen Gulfhauses der Region darstellt, also eines Wohnstallhauses wie das meines Urgroßvaters.
Beim Blick in Kultur- und Feuilletonseiten fällt auf, es gibt zahlreiche Artikel, die zeigen, dass es offenbar wieder relevant ist, wo und wie man lebt. Die Schriftstellerin Juli Zeh lebt in einem Brandenburger Dorf und hat ebenfalls ein viel gelesenes Buch über das Landleben geschrieben.
Ich glaube, diese Debatte wird virulent, weil nicht mehr nur Arme, sondern auch die Mittelschicht bedroht ist. Die Verdrängung trifft inzwischen auch Gutverdienende, also Menschen, die ihren Frust formulieren und medial leichter verbreiten können. Die Wohnung ist ja auch ein Schutzraum und emotional hoch aufgeladen: Erinnerung, Identität, Geschichte. Wenn all das verloren zu gehen droht, steht plötzlich das ganze Leben auf dem Spiel. Wenn dann ein Neubau, der einen Bestandsbau oder eine Freifläche ersetzt, nicht auf das eingeht, was an dem Ort war oder was sich nebenan befindet, wirkt dieser Neubau als gebaute Bedrohung der eigenen Existenz. Eine Festung des Finanzkapitals. Das ist dann die permanente Gegenwart. In Anlehnung an Richard Sennett würde ich sagen: Diese Situation ist perfekt für den flexiblen Menschen; lauter austauschbare Objekte an geschichtslosen Orten. Wir verlieren unsere Heimat, unsere Persönlichkeit, und lernen, überall zu leben – und nirgendwo.
--
Jan Brandt
Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt
Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt
Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden / Von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen







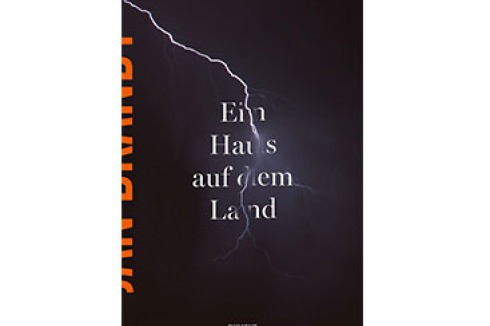



0 Kommentare