Wellenbrecherinnen der Architektur
Eine kommunikative Wende, weitgehend von Frauen getragen, findet in der Architektur statt. Doch zeigt ein Blick nach Dänemark: Sichtbarkeit in der Vermittlung bedeutet nicht automatisch Einfluss in Führung oder Gestaltung.
Text: Lægring, Kasper Aarhus
Wellenbrecherinnen der Architektur
Eine kommunikative Wende, weitgehend von Frauen getragen, findet in der Architektur statt. Doch zeigt ein Blick nach Dänemark: Sichtbarkeit in der Vermittlung bedeutet nicht automatisch Einfluss in Führung oder Gestaltung.
Text: Lægring, Kasper Aarhus
Der Begriff „Architekt:in“ umfasst heute weit mehr als „jemand, der sich mit dem Bauen beschäftigt“. Heutzutage ist Architekt:in, wer Informationen managt, Websites gestaltet, Außenbeziehungen mitbestimmt. Kurz: jemand, der Dinge organisiert – und das in einem immer komplexeren, global vernetzten Feld. So ungefähr formulierten es Bernard Tschumi und Irene Cheng 2003. Im selben Jahr präsentierten Rem Koolhaas und sein Office for Metropolitan Architecture die bildgewaltige Ausstellung „Content: Triumph of Realization“, die den medienvermittelten Zustand der zeitgenössischen Architektur reflektierte und gleichzeitig als Titel eines bunten Katalogs diente. Die Grenze zwischen Architektur und Werbekultur wurde dabei verwischt.
2005 erklärte der spanische Architekt Alejandro Zaera-Polo in seinem Aufsatz „The Hokusai Wave“, dass Kommunikation zur obersten Priorität für Architekturbüros geworden sei. Die Globalisierung des Berufs mache interkulturelle „Übersetzungen“ notwendig, um komplexe Projekte vermittelbar zu machen. Zur Veranschaulichung nutzte er Hokusais berühmten Holzschnitt „Die große Welle von Kanagawa“ von 1829, um das Entwurfsprinzip seines Büros, Foreign Office Architects, für den siegreichen Wettbewerbsbeitrag zum „Yokohama International Port Terminal“ von 2002 metaphorisch zu beschreiben.
Nie zuvor war strategische Kommunikation so wichtig für die Architektur wie heute. Bjarke Ingels’ weltweiter Erfolg bestätigt: Rhetorik und Vermittlung sind feste Bestandteile architektonischer Praxis geworden.
Ein Paradox zwischen Gender und Kommunikation
Gerade in Dänemark, wo Gleichstellung von Frauen und Männern seit Jahrzehnten als gesellschaftliches Ziel hochgehalten wird, zeigt sich ein Paradox: Seit 1908 dürfen Frauen den Beruf der Architektin erlernen – gefeiert wurde dieses Jubiläum 2008 mit der Konferenz „Female Forces in Architecture“. 17 Jahre später wachsen zwar die Kommunikationsabteilungen in Architekturbüros, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind, aber in den Spitzenpositionen sind Frauen noch immer auffällig unterrepräsentiert. Viele haben in Kommunikationsabteilungen der großen Büros oder beim Dänischen Architekturzentrum Fuß gefasst – aber als Eigentümerinnen, Partnerinnen, Strateginnen oder kreative Leiterinnen sieht man sie seltener.
Gerade in Dänemark, wo Gleichstellung von Frauen und Männern seit Jahrzehnten als gesellschaftliches Ziel hochgehalten wird, zeigt sich ein Paradox: Seit 1908 dürfen Frauen den Beruf der Architektin erlernen – gefeiert wurde dieses Jubiläum 2008 mit der Konferenz „Female Forces in Architecture“. 17 Jahre später wachsen zwar die Kommunikationsabteilungen in Architekturbüros, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind, aber in den Spitzenpositionen sind Frauen noch immer auffällig unterrepräsentiert. Viele haben in Kommunikationsabteilungen der großen Büros oder beim Dänischen Architekturzentrum Fuß gefasst – aber als Eigentümerinnen, Partnerinnen, Strateginnen oder kreative Leiterinnen sieht man sie seltener.
Katja Viltoft, Partnerin und kreative Direktorin bei JJW Arkitekter, beschrieb 2022 die Lage treffend: Obwohl genauso viele Frauen wie Männer ausgebildet werden, sind zwei von drei Angestellten in den vierzig größten Architekturbüros Dänemarks Männer. Möglicherweise hängt das mit Unterschieden im Ausbildungsprofil früherer Generationen zusammen. Die gleiche Verteilung gilt für die Führungsebene, obwohl sich hier einiges getan hat, wie Viltoft einräumt. Doch beim Blick auf die Eigentümerstruktur offenbart sich ein anderes Bild: „Unter den vierzig größten Architekturbüros gibt es nur ein einziges, bei dem die Mehrheit der Anteile einer Frau gehört – Dorte Mandrup.“
A gang of nice guys
Dorte Mandrup ist international sehr erfolgreich, und doch zeigt ihr Fall, wie das stereotype Bild vom „heldenhaften, männlichen Architekten“ weiterhin ohne Kritik verbreitet wird. Der Architekturhistoriker Hans Ibelings kommentiert ironisch, dass die Gründerin der sogenannten „neuen Welle“ in der dänischen Architektur aus genau jener Bewegung herausgeschrieben wurde. Sie gründete ihr Büro bereits 1999 und fiel damit aus dem Raster jener „jungen“ Szene der 2000er-Jahre – obwohl das Buch „The New Wave in Danish Architecture“ von 2012 explizit diese darstellen sollte.
Mandrup selbst widersetzt sich einfachen Kategorisierungen, betont jedoch ihre Pionierinnenrolle: „Ich habe mich nie als Teil des niederländischen oder dänischen Pragmatismus gesehen. Aber in Dänemark waren wir die Ersten, die das streng neomoderne Idiom in Frage stellten, das lange Zeit Mainstream war.“ Der Herausgeber des Buchs, Kristoffer Lindhardt Weiss, legte den Fokus darauf, dänische Architekturbüros im Kielwasser von Rem Koolhaas zu positionieren, was sich rückblickend als Nachteil für Frauen in der Branche herausstellte. Schon damals äußerte Kjeld Vindum, der das Buchprojekt begleitete, deutliche Zweifel: „Sie sind ‚a gang of nice guys‘ – aber wo sind die Frauen?“.
Allerdings: Eine vergleichbare Publikation von 1999, herausgegeben von der heutigen Rektorin der Kopenhagener Architekturschule, Lene Dammand Lund, enthielt einen deutlich höheren Frauenanteil – tatsächlich mehr als die Hälfte.
Verantwortung tragen für Führung, für Wirtschaft, für Kreativität
Man könnte meinen, dass „The Hokusai Wave“ auch Frauen in der Architektur zu mehr Sichtbarkeit verholfen hätte. Die Realität sieht aber so aus, als würden sie eher im seichten Wasser planschen, statt kraftvoll auf einer großen Welle reiten. Ironischerweise zeigen historische Forschungen, dass es in der Vergangenheit oft stärkere „Wellenbewegungen“ weiblicher Beteiligung gab als sie in den glatt inszenierten Coffee-Table-Büchern erscheinen. Das Forschungsprojekt „Women in Danish Architecture 1925–1975“ der Universität Kopenhagen hat nicht nur den vergessenen Beitrag von Architektinnen zum Wohlfahrtsstaat aufgedeckt, sondern auch deren stark kollektive Arbeits- und Organisationsformen. Die Mythen vom einsamen, genialen Architekten – sei es nun ein Mann oder eine Frau – sind schon lange überholt.
Man könnte meinen, dass „The Hokusai Wave“ auch Frauen in der Architektur zu mehr Sichtbarkeit verholfen hätte. Die Realität sieht aber so aus, als würden sie eher im seichten Wasser planschen, statt kraftvoll auf einer großen Welle reiten. Ironischerweise zeigen historische Forschungen, dass es in der Vergangenheit oft stärkere „Wellenbewegungen“ weiblicher Beteiligung gab als sie in den glatt inszenierten Coffee-Table-Büchern erscheinen. Das Forschungsprojekt „Women in Danish Architecture 1925–1975“ der Universität Kopenhagen hat nicht nur den vergessenen Beitrag von Architektinnen zum Wohlfahrtsstaat aufgedeckt, sondern auch deren stark kollektive Arbeits- und Organisationsformen. Die Mythen vom einsamen, genialen Architekten – sei es nun ein Mann oder eine Frau – sind schon lange überholt.
Zum Glück zeigen Initiativen wie Sophie Bechs Podcast TOPKVINDER (Spitzenfrauen) neue Perspektiven auf. Ziel ist es, Frauen in Führungspositionen der Architektur sichtbarer zu machen. So berichtet Signe Kongebro von Henning Larsen Architects: „In vielen Architekturbüros tragen Partnerinnen vor allem die wirtschaftliche Verantwortung – während Männer weiterhin den kreativen Teil dominieren.“ Ein alter Zustand also – mit neuer Verpackung.
Bekanntlich kann eine Welle sowohl befreiend als auch bedrohlich wirken – je nachdem, wie gut man das Wasser beherrscht. Frauen fehlt es nicht an Können, um die Welle zu reiten. Was ihnen fehlt, ist ein diskursives und strukturelles Surfbrett, das sie trägt und sie nicht versenkt.
Aus dem Dänischen: my
Aus dem Dänischen: my


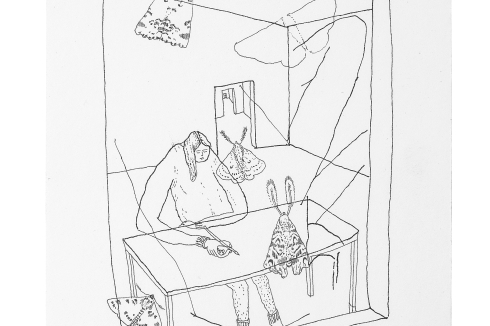




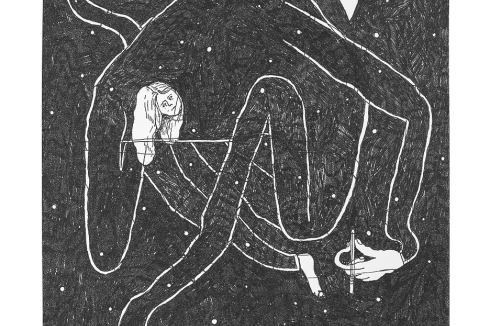
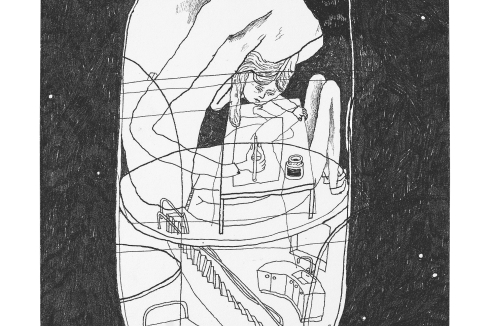
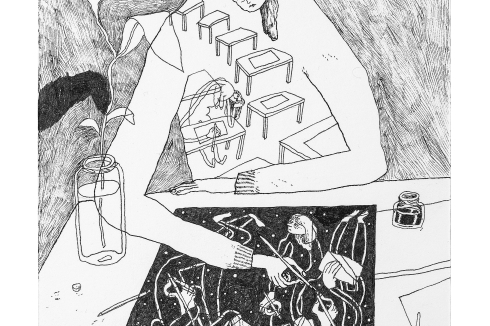



0 Kommentare