Wie soll Städtebau gelehrt werden?
Zwei Positionspapiere fordern eine Neuausrichtung der Städtebauausbildung an deutschen Hochschulen. Auf die "Kölner Erklärung" folgte
"100 % Stadt". Die Sorge um den Zustand der Europäischen Stadt treibt beide Lager um.
Text: Doris Kleilein
Im Mai diesen Jahres initiierte Christoph Mäckler gemeinsam mit einer Reihe von Stadtplanern die "Kölner Erklärung", ein Positionspapier, in dem eine Neuausrichtung der Städtebauausbildung an deutschen Hochschulen gefordert wird. Nach einer Beschreibung des Status Quo ("Deutschland war noch nie so wohlhabend, seine Stadträume waren aber noch nie so armselig") fordern die Unterzeichner, dass in Zukunft nicht nur einzelne Teildisziplinen, sondern "umfassender Städtebau" gelehrt werden soll.
Seit kurzem gibt es ein weiteres Positionspapier, das sich als Gegenentwurf zu der von Mäckler skizzierten Haltung versteht: "100 % STADT" fordert ebenfalls eine neue Städtebauausbildung und darüber hinaus ein offenes Verständnis von Stadt. "Stadt ist nicht auf Traufhöhe und Fassadenmaterial und -farbe zu reduzieren", so die Initiatoren um Frauke Burgdorff, Andreas Fritzen und Christa Reicher. Architekturstudierende sollten vielmehr lernen, dass sie ein "ein lebendiger und kenntnisreicher Teil der Aushandlungsprozesse um Stadt" seien.
Die Bauwelt veröffentlicht an dieser Stelle beide Positionspapiere erstmals in der vollständigen Fassung:
100 % STADT Positionspapier zum Städtebau und zur Stadtentwicklung
Was meinen Sie? Wie kann die Städtebauausbildung verbessert werden? Durch mehr Partizipation und die Auseinandersetzung mit der Komplexität der Stadt? Oder durch die intensive Vermittlung des "Einmaleins des Städtebaus"mit konkretem Handwerkszeug für Straße, Platz, Block und Haus? Sollen sich angehende Architektinnen und Architekten verstärkt mit Verkehrsplanung oder dem Klimawandel beschäftigen? Und wie wird das unser Bild der Stadt verändern? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.


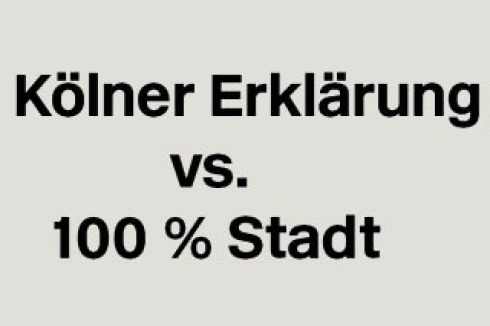







18 Kommentare